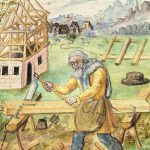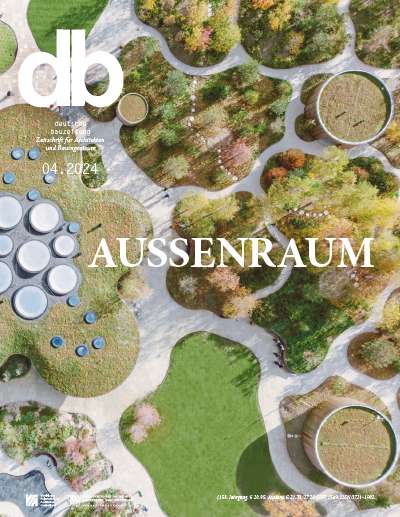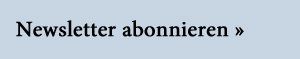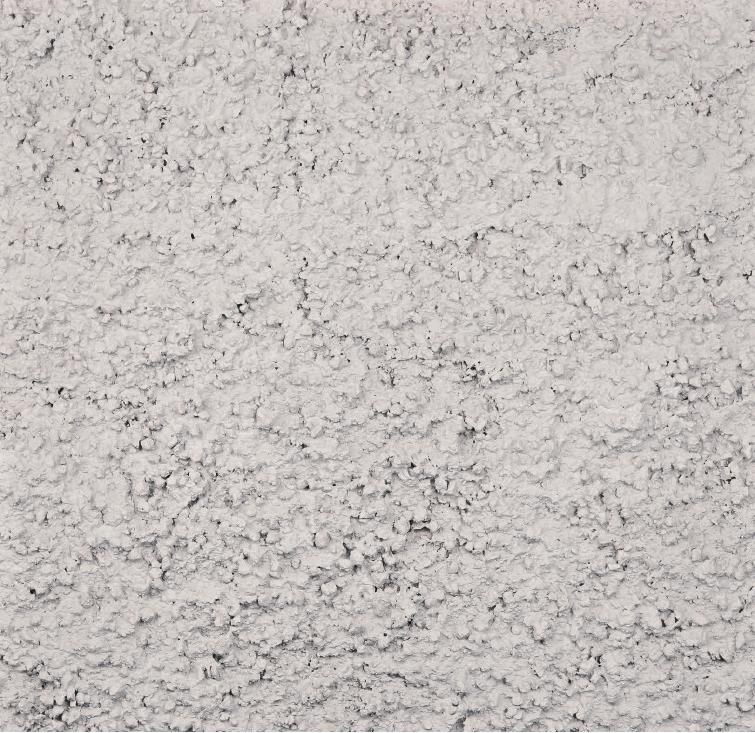Erfolgreiche Sanierungen erfordern Kenntnisse historischer Baumethoden. So auch beim Fachwerk: Was ist z.B. der Unterschied zwischen Stockwerks- und Geschossbauweise? Wie steht es um die Statik? Wie lassen sich typische Schäden effizient beheben?
Text und Fotos: Christian Kayser
Fachwerk – was heute, etwa bei


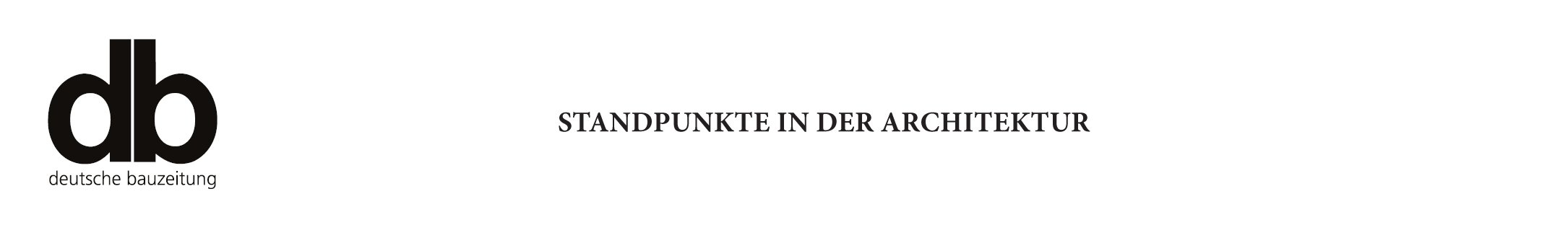


 Unter Dach und Fach
Unter Dach und Fach