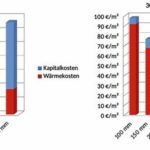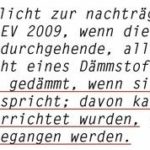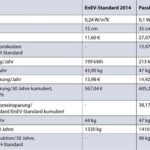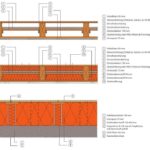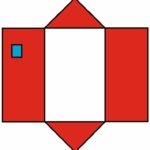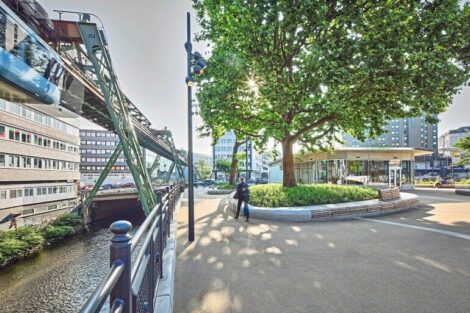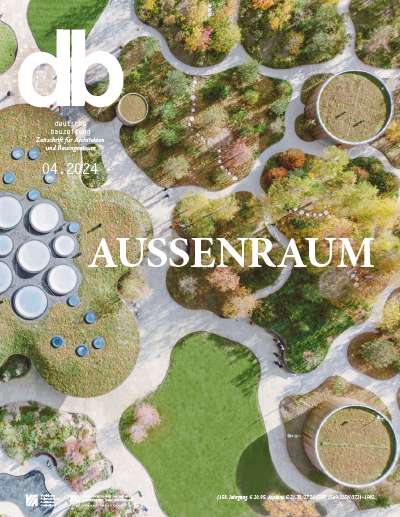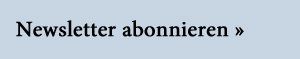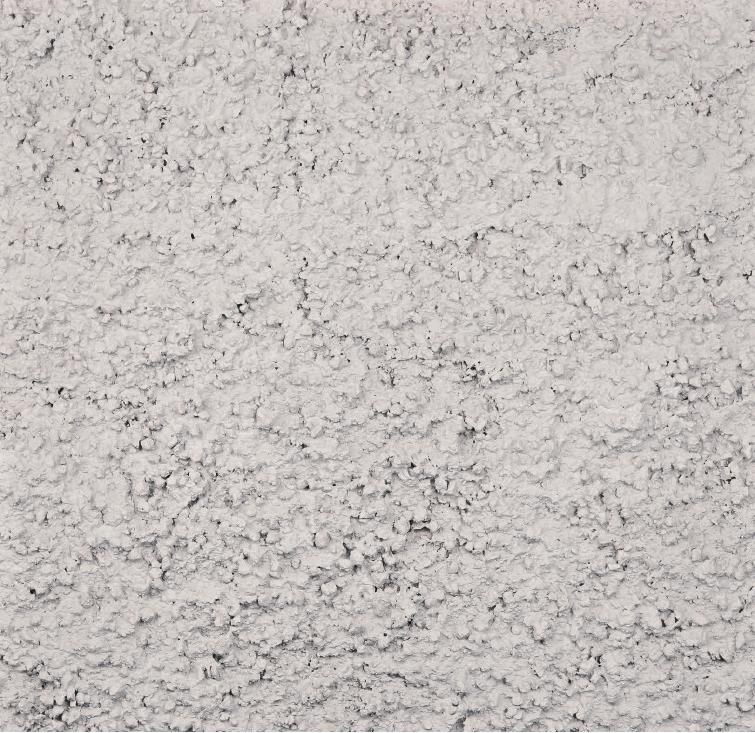Die oberste Geschossdecke zu dämmen, gilt als besonders preiswerte Möglichkeit der energetischen Sanierung. Daher beleuchten wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen, hinterfragen die Wirtschaftlichkeit und zeigen schadensfreie Ausführungsvarianten.
Text: Arnold Drewer, Lars Hoischen
Um den Gebäudeenergieverbrauch durch eine energetische Sanierung der obersten Geschossdecke zu senken, verlangt die EnEV 2014 die


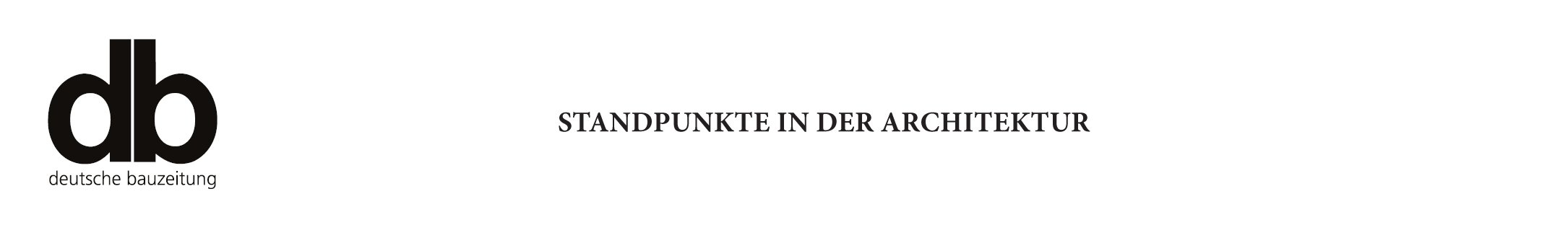


 Luft nach oben
Luft nach oben